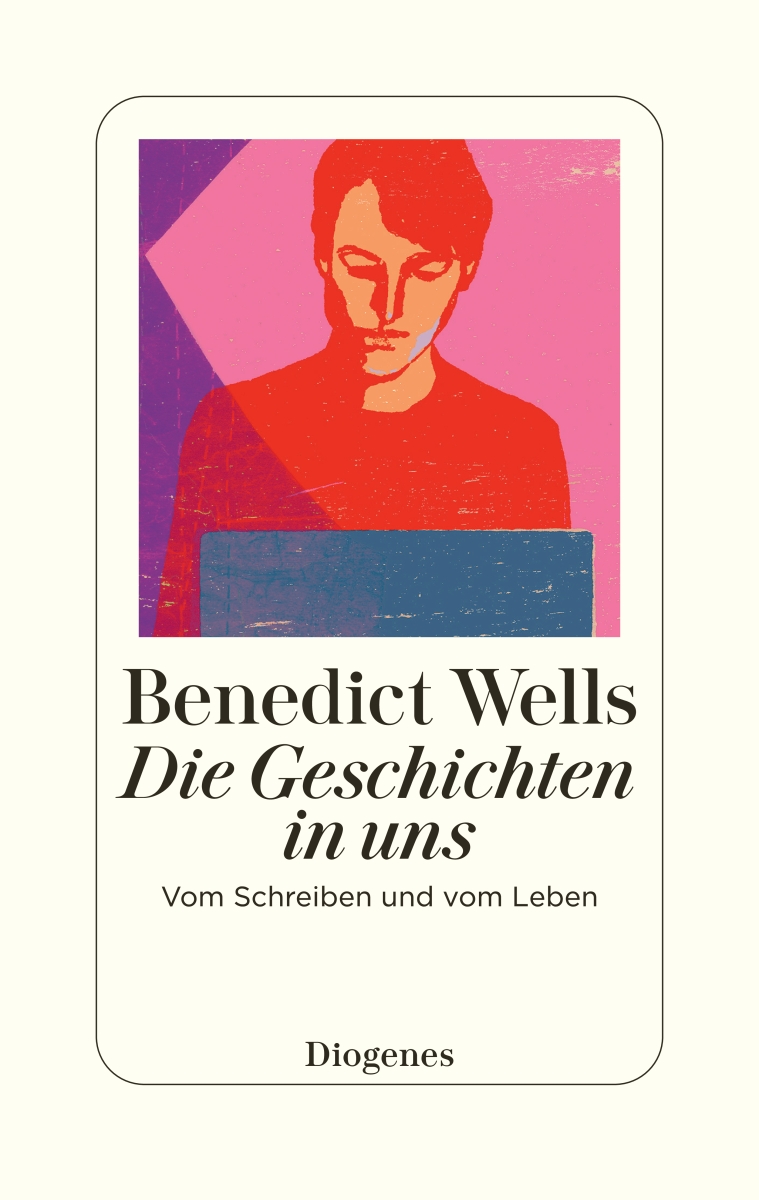
Sich trauen, dranbleiben und überarbeiten.
Mein Regal ist gefüllt mit Schreibratgebern und Biografien von Schriftstellerinnen. Ich liebe es, über die Schreibleidenschaft anderer Menschen zu lesen und Einblicke in deren Vorgehensweisen beim Schreiben zu erhalten. In den letzten Jahren habe ich mich vor allem für schreibende Frauen interessiert. Ich habe über Astrid Lindgren oder Selma Lagerlöf gelesen, aber auch solche Bücher wie „Schreibtisch mit Aussicht“ (herausgegeben von Ilka Piepgras) mit kurzen Texten von Autorinnen zu ihrem Schreiben.
Jeder trägt Geschichten ins sich
Zu Weihnachten lag dann das Buch von Benedict Wells unterm Baum. „Die Geschichten in uns“ ist schon ein Titel, der ich sofort neugierig gemacht hat und anzieht. Hierin zeigt sich für mich die Vorstellung, dass alle Menschen etwas zu erzählen haben und jede Person schreiben könnte. Dieser Titel öffnet den Raum zum Schreiben für viele Menschen. Er schließt nicht aus und macht das Schreiben nicht zu einem Genie-Mythos.
Ein Buch über sein Schaffen und seinen Rat für Schreibende
Und diese Erwartungen hat Benedict Wells in seinem Buch „vom Schreiben und vom Leben“ (so der Untertitel) auch erfüllt. Wells schenkt uns in diesem Sachbuch einen Einblick in sein Leben als Schriftsteller und seiner Schreibwerkstatt. Das Buch hat er in 2 größere Teile gegliedert. Knapp 1/3 des Buches umfasst seinen persönlichen „Weg zum Schreiben“ und sein Leben als Schriftsteller. Das Sachbuch ist damit auch zum Teil ein Memoir. Aber es ist auch eine Reflexion, wieso er selbst aber auch andere Menschen gerne schreiben oder einen Roman schreiben wollen. 2/3 des Buches sind dann der Schreibratgeber – „Über das Schreiben“. Benedict Wells beschreibt zunächst seinen Schreibprozess und die einzelnen Phasen. Danach geht er sehr ausführlich auf einzelne Werkzeuge des Überarbeitens ein.
1. Teil – „Weg zum Schreiben“
Absolut begeistert hat mich der erste Teil des Buches. Benedict Wells erzählt von seinen Anfängen und seinem tiefen Wunsch zu schreiben. Ein Auslöser war der Jugendroman „Crazy“ von Benjamin Lebert, den dieser mit 17 Jahren veröffentlichte. Spannend für Wells war, dass tatsächlich jemand schon mit 17 einen Roman publizieren konnte und dann auch noch über das Leben in einem Internat. Denn auch Wells verbrachte viele Jahre als Jugendlicher im Internat. Nach der Schule zog er nach Berlin und entschied sich für das Schreiben und gegen ein Studium, auch wenn er sich an einer Uni einschrieb, um mit dem Semesterticket bequem U-Bahn fahren zu können. In diesen ersten Jahren des Schreibens arbeitete er in vielen verschiedenen Nebenjobs, lebte eher bescheiden und schrieb. Immer wieder gab er seine Texte auch raus, an einen alten Lehrer zum Beispiel. Und erhielt dabei vor allem viel Kritik. Ihm wurde in den ersten Reaktionen auf seine Texte nicht das große Talent bescheinigt. So gab er seinen ersten Roman in Berlin an den Ex-Freund seiner Schwester, der war „ein kritischer Literaturliebhaber. Also jemand, der sicher zu schätzen wissen würde, was für ein unglaubliches Erstlingswerk ihm der Zufall in die Hände gespielt hatte. Als er fertig gelesen hatte, kam er auch noch nachts direkt bei mir vorbei. Wahnsinn, dachte ich. Zwei Jahre hatte ich mir gegeben, um es als Schriftsteller zu schaffen, nun hatte ich das Ziel vielleicht schon nach wenigen Monaten erreicht. ‚Und, wie findest du es?‘, fragte ich sofort. Er steckte sich erst mal eine Zigarette an und zuckte mit den Schultern. ‚Joa‘, sagte er. Sekundenlange Stille. Dann fing er endlich an und zählte nach ein paar höflich lobenden Anfangsworten auf, was bei meinem Buch alles schlecht, verwirrend, seltsam und unverständlich war oder schlicht nicht funktionierte.“ (S. 58).
Fazit vom 1. Teil: Dranbleiben
Manche rieten ihm sogar, das Schreiben lieber sein zu lassen. Doch Benedict Wells schrieb weiter und wollte es besser machen. Er schrieb und überarbeitete.
Und das ist es, was mich so angezogen und begeistert hat. Benedict Wells erschafft keinen Schriftsteller-Mythos, schreibt nicht darüber, wie er ständig Geistesblitze hatte, im Flow war und hochgelobt wurde und irgendwie alles leicht ist, wenn man nur will. Er vermittelt das Gefühl, ein mittelmäßiger Autor gewesen zu sein, seine Anfänge waren schwer. Aber er ist einfach dran geblieben. Oder er war trotzig, so wie er es von sich selbst sagt. Er wollte dran bleiben und biss sich durch. Damit ist dieser Teil des Buches durchaus ernüchternd – und doch auch ermutigend. Das Schreiben eines Romans kann Jahre dauern (bei einem seiner Bücher waren es 7 Jahre). Das Schreiben eines Romans darf Jahre dauern. Bei mir kam das Gefühl auf, ich darf mir Zeit lassen, ich darf mir Zeit nehmen und ich kann es schaffen. Und eines kann ich hier noch wirklich von ihm lernen: Dranbleiben. Nach dieser Lektüre dachte ich einfach nur: Ich werde nicht aufgeben.
2. Teil – „Über das Schreiben“
In seinem Ratgeber-Teil Über das Schreiben geht Benedict Wells zunächst auf den Schreibprozess unter der Überschrift Wie ein Roman entsteht ein. Er teilt dies in die Phasen: a) Der Funke, b) Das Davor, c) Das Aufschreiben, d) Das Überarbeiten.
Mit diesen vier Phasen nimmt er (unbewusst) die Erkenntnis auf, die ich aus der Schreibprozessforschung kenne: So gut wie jedes Schreiben teilt sich in drei große Phasen ein: das Planen, das Formulieren, das Überarbeiten (s. Flower & Hayes 1980; Hayes 2012). Und doch weist Wells daraufhin, dass es „keine Formel für kreatives Schreiben (gibt), und wenn, wäre sie von Autorin zu Autor eine andere.“ (S. 107f.). Darum ist auch dieser Teil des Buches größtenteils in der Ich-Form verfasst. Nur an manchen Stellen verwendet er das verallgemeinernde „man“ – immer dann, wenn er davon weiß, dass es anderen Autoren und Autorinnen ähnlich geht oder der Gedanke durchaus etwas Universelles haben könnte (S. 108).
Auf knapp 40 Seiten handelt Wells diese Phasen des Schreibens ab. Im Gegensatz zu anderen Schreibratgebern, die ich bereits gelesen habe, kommen den ersten Phasen Planen und Formulieren für Wells scheinbar weniger Bedeutung zu. In anderen Ratgebern wird zum Beispiel ausführlich darüber geschrieben, wie man zunächst seine Figuren ausarbeitet und den Handlungsstrang plant. Viele legen Wert auf bestimmte Techniken des Plottens. Hierin zeigt sich, wie unterschiedlich Schreibende die Phasen bewerten oder für sich nutzen. Aus diesem Grund ist das Buch von Wells in diesem Punkt erfrischend, denn ich bin beim Schreiben keine Planerin, sondern finde die Figuren und manch Handlungsstränge erst beim Schreiben selbst. Aber irgendwie war mir der Teil zum Schreibprozess persönlich etwas zu kurz, auch wenn ich nicht sagen kann, was ich vielleicht erwartet hätte. Beziehungsweise tauchen im nächsten Teil des Buches dann Dinge auf, die ich wiederum irgendwie schon mit den Schreibphasen verbunden hätte.
Immer noch 2. Teil – „Werkzeuge zum Überarbeiten“
Im nächsten Teil gibt Benedict Wells uns Werkzeuge zum Überarbeiten an die Hand. Die Werkzeuge nehmen gut die Hälfte der Seitenzahl des Buches ein. Auf fast 200 Seiten geht Wells auf verschiedene Möglichkeiten ein, einen Text zu verbessern mit Blick auf die Sprache, aber auch auf die Charaktere, auf die Struktur, auf die Erzählperspektive.
Interessanterweise finden sich hier aber auch Kapitel, die ich früher erwartet hätte. Ein Kapitel heißt zum Beispiel Das Notizbuch. Für mich ist dies ein ständiger Begleiter des Schreibens und wäre für mich kein Werkszeug des Überarbeitens. Auch bei Wells liest es sich mehr so, als wäre es wichtig, einfach immer etwas bei sich zu haben, um Ideen und Gedanken zum Roman festhalten zu können und diese nicht auf dem Weg nach Hause zu verlieren. Auch das darauffolgende Kapitel Eigene Zeiten, Orte und Methoden gehört für mich in alle Phasen des Schreibens und vor allem beim Aufschreiben. Finde deine Zeit und deinen Ort, wo du am besten schreiben kannst. Lass dich dabei ruhig von anderen Schreibenden inspirieren, die vielleicht am liebsten morgens schreiben oder zwischen den Schreibzeiten spazieren gehen. So verweist auch Benedict Wells auf die Schreibgewohnheiten anderer Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Das liebe ich.
Die Werkzeuge zum Überarbeiten sind für mich ein Fundus und eine Inspiration zum Bearbeiten meiner Texte. Ein strukturierter Ratgeber ist es jedoch nicht. Eine Logik in seiner Kapitelanordnung kann ich nicht wirklich erkennen. Aber vielleicht auch deshalb, weil auch hier Kreativität und Individualität eine Rolle spielen, wir nicht immer demselben Plan folgen können. Und so hat es mich begeistert, auch diesen Teil des Buches zu lesen, denn er bezieht sich immer wieder auch auf andere Autorinnen und Autoren und kommt so meiner Leidenschaft entgegen, einfach mehr über andere schreibende Menschen zu erfahren.
3. Teil – „Blick in die Werkstatt“
Abgerundet wird das Buch durch einen Blick in seine Textwerkstatt. Das heißt, er zeigt, frühere Ausschnitte aus seinem Roman Vom Ende der Einsamkeit. Wells lässt uns also die ersten Versuche lesen und stellt dann seine Überarbeitungen an dem Text vor. So bekommen wir ein Verständnis davon, wann er manchmal nur auf sprachlicher Ebene arbeitet und einzelne Wörter oder Sätze ändert und wann er durchaus ganze Passagen überarbeitet, die Perspektive wechselt und auch radikal löschen muss. Wir sehen, wie Wells den Text verändert. Das kommentiert auch für die Lesenden. Das heißt, wir erfahren auch, warum er bestimmte Veränderungen vorgenommen hat.
Den dritten Teil des Buches – die Werkstatt – beginnt Wells mit einer kleinen Warnung. Um zu zeigen, wie er seinen Roman Vom Ende der Einsamkeit überarbeitet hat, zeigt er zuerst, wie der ursprüngliche Anfang des Romanes lautete. Dazu vermerkt er aber: „Der ging – unbearbeitet, Lesen auf eigene Gefahr! – nämlich so“ (S. 349). Er ist schon selbst nicht mehr von seinen ersten Fassungen überzeugt und schreibt auch immer mal wieder, dass ihm diese ersten Texte etwas peinlich sind. Darum warnt er die Lesenden lieber mal. Solch kleine Spitzen, ein kleiner Sarkasmus und ein durchaus humorvoller Blick auf sich selbst ziehen sich durch Wells’ Buch. Und das macht es so sympathisch, macht ihn sympathisch. Er kommt nicht wie der erfahrene Schriftsteller daher, sondern wie der hart arbeitende und zweifelnde Autor. Es macht in nahbar, er zeigt sich verwundbar. Und dafür bewundere ich ihn.
Fazit
Ich habe dieses Buch ins Herz geschlossen, weil es für mich eben den Raum zum Schreiben öffnet und alle einlädt, das Schreiben auszuprobieren und sich zu trauen, seiner Leidenschaft zu folgen und am Ball zu bleiben.
– Nora –
„Die Geschichten in uns“ von Benedict Wells
(Memoir und Ratgeber, erschienen 2024 bei Diogenes)
Hier geht’s zum Buch beim Verlag: „Die Geschichten in uns“
Die Website des Autors mit zahlreichen Einblicken in sein Schaffen und Leben als Schriftsteller: Benedict Wells
Noch mehr Inspiration:
In unserem Bücherregal findest du meine Buchvorstellungen zu spannenden biografischen Bücher über Schriftstellerinnen. Diese Bücher geben uns Einblicke in die Arbeitsbedingungen schreibender Frauen, aber auch in ihre Motivation und Hoffnung, ihr Durchhaltevermögen und ihren Biss.
– „Schaff euch Schreibräume!“ von Judith Wolfsberger
– „Dichterinnen und Denkerinnen“ herausgegeben von Katharina Herrmann
– „Ich schreibe, also bin ich“ herausgegeben von Simone Frieling

Hinterlasse einen Kommentar